H0-Anlage nach Epoche II - Motiven
Deutsche Reichsbahn



© Copyright - All Rights Reserved - Thomas Noßke - www.epoche2.de; 1998-2016
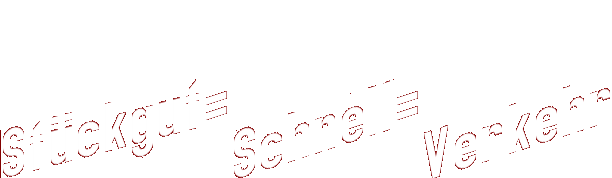
Leichtgüterzüge für den Stückgut-Schnellverkehr
Bereits Mitte der 20er Jahre sah sich die Deutsche Reichsbahn einer stark zunehmenden Konkurrenz durch den Straßenkraftverkehr ausgesetzt. Besonders bedrohlich zeigte sich dies im Bereich des Stückgutverkehrs. Die kleinen motorisierten Rollfuhr-Unternehmer konnten im Nahbereich flexibler und schneller agieren als die Eisenbahn, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt mit ihrem weitestgehend flächendeckenden Schienennetz im Vergleich zum noch recht bescheiden ausgebauten Fernstraßennetz in einem gewissen infrastrukturellen Vorteil war. Aber auch dieser Vorteil schmolz durch den zunehmenden Ausbau der Straßen von Jahr zu Jahr weiter dahin.
Bahneigene Untersuchungen ab 1925 hatten gezeigt, daß die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Nahgüterzuges, der auf jeder Station Stückgut aufnahm oder zustellte, nur 10 km/h betrug. Der Hauptgrund dafür ist in den zahlreichen erforderlichen Rangierbewegungen an den Laderampen der Stationen zu sehen.
Im Jahre 1927 entwickelte deshalb die Hauptverwaltung der Reichsbahn einen Plan zum Einsatz moderner Dieseltriebwagen für den ausschließlichen Betrieb im Stückgut-Nahverkehr. Dadurch sollten insbesondere die sonst bei lokbespannten Zügen erforderlichen zahlreichen und zeitraubenden Kupplungsmanöver auf ein äußerstes Minimum reduziert werden. Allerdings war die Industrie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, kurzfristig einen technisch ausgereiften Triebwagen für diesen Zweck in nennenswerten Stückzahlen anzubieten. Dennoch wurde dieses Ziel keinesfalls aus den Augen verloren.
Im Jahre 1928 wurde in der RBD Köln eine Lösung entwickelt, welche kurzfristig realisierbar war und als vorübergehende Lösung Erfolg versprach. Es wurden kurze und damit leichte Nahgüterzüge mit vergleichsweise schnellen Personenzug-Lokomotiven ausschließlich für den Stückgutverkehr gebildet. In den auf zehn Wagenachsen beschränkten Zügen sollten während der Fahrt die Güter bereits vorsortiert werden, damit die Standzeiten zum Be- und Entladen an den Stationen möglichst gering gehalten werden konnten. Für das erforderliche Personal in diesen leichten Nahgüterzügen sollte ein Güterzug-Gepäckwagen als Aufenthaltsmöglichkeit dienen. Außerdem wurde in die verwendeten gedeckten Wagen Gasbeleuchtung und Heizung eingebaut und teilweise kleine Fenster in die Seitenwände gesetzt. Für große sperrige Güter und für feuergefährliche Güter wurden in diesen Zügen bei Bedarf auch Rungenwagen mitgeführt.

Um eine freizügige Beweglichkeit des Personals zu ermöglichen, wurde dieser Güterzug-Gepäckwagen mit einem großräumigen gedeckten Güterwagen der Verbandsbauart auf besondere Weise kurz gekuppelt. In die angrenzenden Stirnseiten wurden größtmögliche Öffnungen geschnitten, welche mit einer Übergangsbrücke und einem Faltbalg verbunden wurden. Es entstand somit eine zusammenhängende Ladefläche von 38,8 m². Jeder der beiden kurz gekuppelten Wagen erhielt an der Seite der festen Kupplung nur einen Puffer ohne Pufferteller und an der anderen Seite eine Stoßplatte. So konnte der Wagenabstand auf 540 mm reduziert werden, bei einer Höhenbeweglichkeit von 40 mm.
Diese zunächst als Provisorium gebauten Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h waren so erfolgreich, daß einzelne davon noch bis in die 60er Jahre im Einsatz bleiben.
Als Packwagen kamen meist die bewährten zweiachsigen preußischen Güterzug-Packwagen der Bauserien ab 1914 zum Einsatz, von denen die Reichsbahn mehrere tausend Exemplare besaß. Es wurden aber zumindest in Einzelfällen auch andere Packwagen eingesetzt. Nachstehendes Foto stammt aus der Sammlung von Joachim Krause und wurde Ende 1929 im Raum Halle/Saale aufgenommen. Es zeigt die Lok 93 760 mit dem Pwg3 pr Halle 93 616 und dem kurz gekuppelten Ghl Dresden 7666. Stationiert war diese Einheit laut den Anschriften am Längsträger des Ghl Dresden auf dem Leipziger Hauptbahnhof.

Anfänglich trugen diese Fahrzeugkombinationen die Bezeichnung "Ersatzgütertriebwagen", aber spätestens 1929 wurde der Begriff "Leig" für Leicht-Güterzug dafür geprägt. Die Seitenwände der gedeckten Wagen wurden mit teilweise recht künstlerischen Aufschriften "Stückgut-Schnellverkehr" in den unterschiedlichsten Schreibweisen versehen. Dafür gab es offenbar anfänglich keine Vorschriften, so daß eine Vielzahl verschiedener Beschriftungsvarianten zu beobachten waren, die sich auch über die gesamte Reichsbahnzeit hielten. Mitunter wurde diese Beschriftung so geschickt angebracht, daß sie auch bei geöffneten Wagentüren noch vollständig lesbar blieb. Häufig wurde die auf obigem Foto erkennbare, gut lesbare und sehr attraktive Variante mit ansteigender schwarzer Schrift auf weißem Grund gewählt.
Schon nach kurzer Zeit wurden auch Kombinationen aus zwei Gl-Wagen Dresden der Verbandsbauart gebaut, wovon einer ein Bremserhaus hatte. In diesem Wagen mit Bremserhaus wurde auch ein Zugführerabteil eingerichtet und die darunter liegende Achse besser gefedert. Diese Fahrzeuge waren für eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h zugelassen.
Bis zum Ende des Jahres 1932 gab es bereits insgesamt 288 Leig-Einheiten in fast allen Reichsbahndirektionen, woraus leicht zu erkennen ist, wie gut sich diese Fahrzeuge bewährt haben.
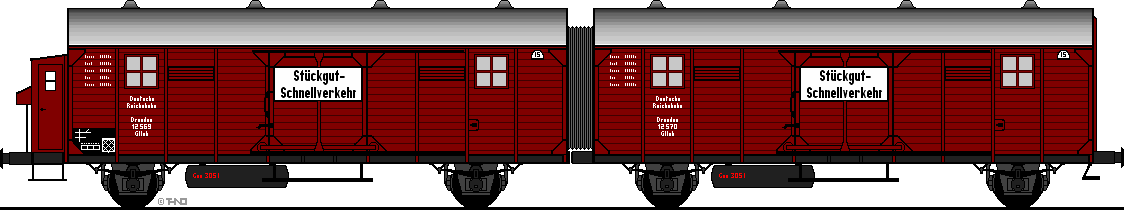
Im Jahre 1930 wurden dann drei echte Gepäcktriebwagen beschafft, die vor allem im westdeutschen Raum zum Einsatz gelangten. Sie basieren auf der Konstruktion der 1924 bis 1929 gebauten Nebenbahntriebwagen 851 - 862 und erhielten die Fahrzeugnummern 10 001 bis 10 003. Sie besitzen einen 150 PS-Dieselmotor, welcher über eine Blindwelle und eine Kuppelstange die beiden Achsen des ersten Drehgestells antreibt. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h und sie besitzen bei 38 m² Ladefläche ein zulässiges Ladegewicht von 15 t. Im Gegensatz zur sonst üblichen Benennung von (Personen-)Triebwagen mit der besitzenden RBD waren diese als Güterwagen eingruppierten Fahrzeuge dem Gattungsbezirk Dresden zugeordnet und wie Gepäckwagen beschriftet.
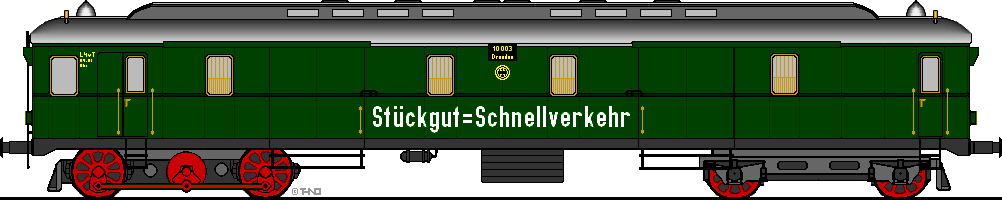
Etwa ab 1933 wurden dann auch Leig-Einheiten aus großräumigen gedeckten Güterwagen der Austauschbauart hergestellt, wofür besonders die Bauserien mit 7,7 m Achsstand Verwendung fanden. Es hat auch einige wenige Fahrzeuge in der Kombination je eines Verbands- und eines Austauschwagens gegeben. Wiederum besaß immer ein Wagen ein Bremserhaus. Alle kurz gekuppelten Wagen des Gattungsbezirkes Dresden erhielten ein zusätzliches Nebengattungszeichen "l". Die in die Leig-Wagen eingebauten Fenster unterschieden sich sowohl in ihrer Form und Größe als auch in ihrer Lage.
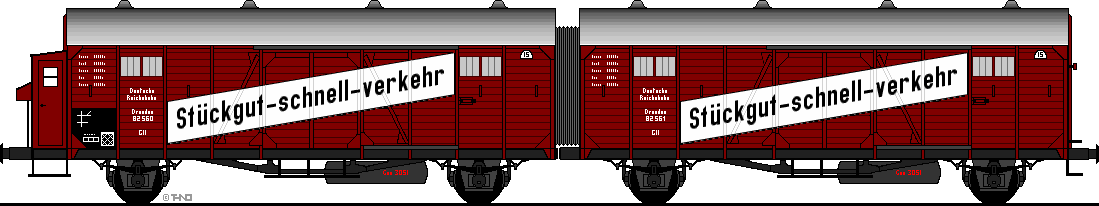
Im Jahre 1941 wurden noch zwei weitere Gepäcktriebwagen gebaut, die jedoch vor dem Kriegsende offenbar nicht mehr in ihrem ursprünglichen Verwendungzweck zum Einsatz kamen. Diese Fahrzeuge mit einem 650 PS-Dieselmotor und einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h hatten den Grundriß der von 1932 bis 1941 in mehreren Bauserien beschafften 22 m langen Einheits-Triebwagen VT137 und trugen die Fahrzeug-Nummern 10 004 und 10 005.
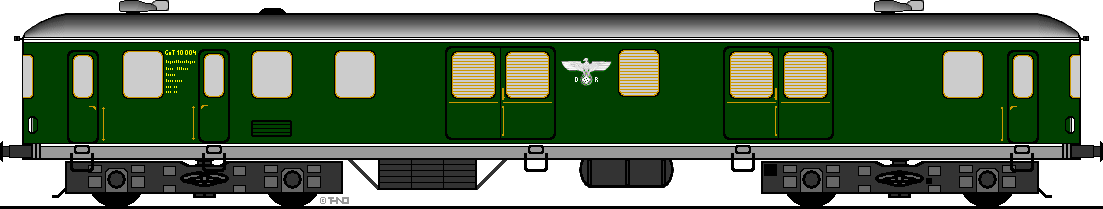
Die letzte Entwicklungsetappe der Leig-Einheiten vor dem Kriegsende bildeten ab 1943 Kombinationen aus zwei großräumigen Wagen der Kriegsbauart (Gattungsbezirk Leipzig). Bei diesen Kombinationen wurde kein Bremserhaus mehr verwendet; es gab nur noch einen offenen Bremserstand, der über die Puffer montiert wurde. Diese Fahrzeuge waren für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zugelassen und wurden noch mindestens bis 1948 in dieser Form in nennenswerten Stückzahlen gebaut.

Nach 1945 sind auch weiterhin aus geeigneten vorhandenen Fahrzeugen Leig-Einheiten gebaut und eingesetzt worden. Die Kombination aus zwei großräumigen gedeckten Wagen der Kriegsbauart war dabei offenbar eine der meist verbreiteten Varianten. Vereinzelt sind Leig-Einheiten bei beiden deutschen Bahnverwaltungen noch bis in die 70er Jahre zum Einsatz gelangt. Durch die aber inzwischen übermächtige Konkurrenz der Kraftfahrzeuge und durch den Einsatz international genormter Container verloren die Leig-Einheiten zunehmend ihre Bedeutung.
Auf Modellbahn-Anlagen der Epochen II und III dürften sie aber weiterhin die Blicke auf sich lenken, denn sie bilden bereits bei kurzen Zuglängen attraktive Züge, die zusammen mit vielen verschiedenen Lokomotiven und relativ hohen Fahrgeschwindigkeiten vorbildgerecht eingesetzt werden können. Bei den Dampflokomotiven dürften die Baureihen 38 und 78 dominieren, aber auch die Baureihen 17, 36, 37, 41, 56, 64, 86 und 93 waren beim Vorbild vor Leigeinheiten anzutreffen. Bei elektrischer Zugförderung waren sicher alle damals vorhandenen Elok-Baureihen, möglicherweise mit Ausnahme der E18 und E19, vor Leig-Einheiten zu finden.